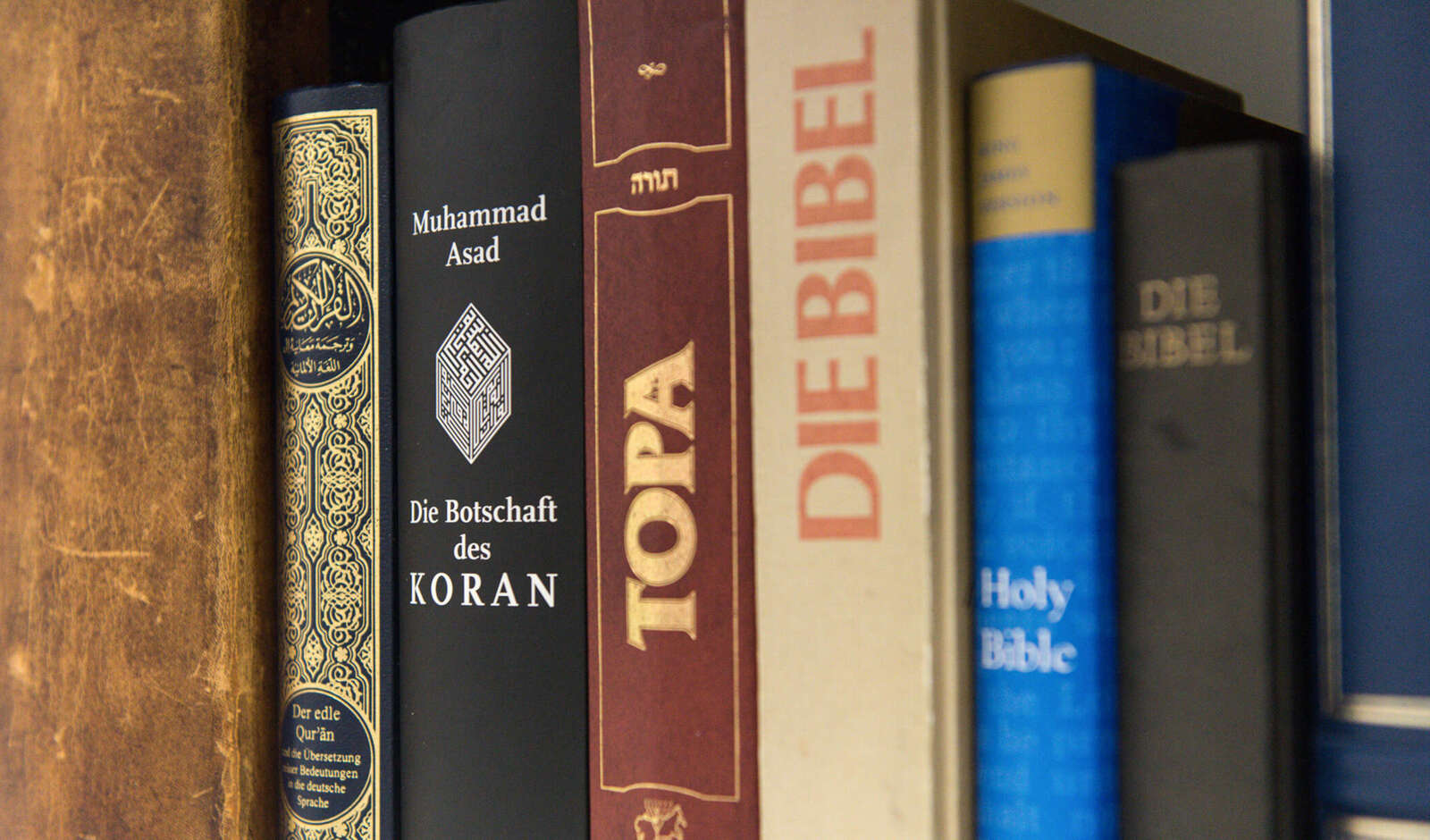«Ich sehe keinen Nutzen für uns.» «Die Bedürfnisse und Probleme unsere Mitglieder sind andere.» «Wir setzen unsere eigenen Prioritäten.» Drei Aussagen aus dem Kreis jüngerer Musliminnen und Muslime, die für ihre Gemeinschaften engagiert sind, lassen aufhorchen. Interreligiöser Dialog? Ein Austausch über theologische Themen über die Religions-
grenzen hinweg? Gemeinsames Nachdenken über Figuren in der Bibel und im Koran? Keine Zeit, keine Lust, keinen Sinn. Es sind nicht Einzelmeinungen, die da formuliert werden, sondern verbreitete Einstellungen, die zunehmend artikuliert werden.
Die junge Generation der Engagierten ist heute zwischen Ende zwanzig und vierzig. Es sind gut ausgebildete Marketing- und Kommunikationsspezialisten, Treuhänder, Juristinnen, Psychologinnen, Sozialarbeiter oder Naturwissenschaftlerinnen. Das persönliche Weiterkommen im Beruf ist ihnen wichtig. Ebenso wichtig ist es für sie, ihre Skills für die Gemeinschaft einzubringen, sie weiterzuentwickeln, ihre Situation zu verbessern. Nicht dort, wo die Gesellschaft es von ihnen erwartet, sondern dort, wo sie selbst die grössten Herausforderungen und den grössten Nutzen sehen. Wer will sich schon mit der Figur des Abraham, mit dem Fasten oder mit Kleiderregeln in Judentum, Christentum und Islam beschäftigen? Zeit und Energie für die Organisation eines Anlasses aufwenden, wenn dann doch nur der immer gleiche, kleine Kreis an Interessierten aufkreuzt, man brav seinen Beitrag neben die beiden anderen stellt, darob in ein relativ oberflächliches Gespräch kommt, bei dem entgegen aller Absicht doch die medialen Themensetzungen, Fragen und Klischees dominieren und man danach zum gemeinsamen Imbiss übergeht.
Zu viele solcher Erfahrungen haben zum kritischen Hinterfragen von Sinn und Nutzen interreligiöser Veranstaltungsformate geführt. Immer öfter entsteht der Eindruck, dass es nicht die eigenen brennenden Themen sind, die da öffentlich verhandelt werden, sondern die Themen, die einem von aussen vorgegeben sind, auf die man sich als kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt hat. Wie authentisch können Akteure in einem solchen Setting sein? Und was sind denn die brennenden Themen der Musliminnen und Muslime und ihrer Communities? Es sind die vielfältigen, teils subtilen, teils offenkundigen Diskriminierungserfahrungen und deren Folgen, die kaum einen Ort und ein Gefäss finden, in denen sie adäquat adressiert werden können. Erfahrungen, die für viele so alltäglich und «normal» geworden sind, dass es ihnen wie eine Offenbarung erscheint, wenn Autorinnen, Aktivisten, Akademikerinnen diese in Büchern beschreiben oder sie mittels Studien erforschen. Die Frage der (religiösen) Identität, Zugehörigkeit, der gesellschaftlichen Rolle, die einem von aussen zugewiesen wird oder die man selber einnehmen möchte, die Fremdzuschreibungen und Selbstzuschreibungen in einem gesellschaftlichen Umfeld, das entweder kein, ein negatives oder ein diffuses Verhältnis zu Religion per se und zum Islam im Speziellen hat, beeinflusst, ob und wie sehr sich Musliminnen und Muslime noch öffentlich in interreligiöse Diskussionen einbringen wollen. Mentale und physische Ermüdungserscheinungen sind zwei von vielen Folgen bei Diskriminierungserfahrungen. Dieser Befund wird in der Rassismusforschung vielfach beschrieben und dürfte mit ein Grund für die eingangs zitierten Aussagen sein.